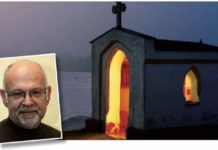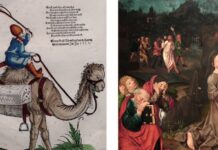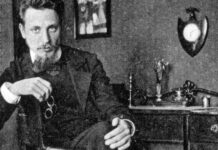Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche gefangen zwischen Traditionen und der Zukunft
Als „Gefangene unseres Besitzes“ – so umreißt Erzbischof Urmas Viilma die Lage der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (EELK). Auf Englisch klingt es poetischer: „prisoners of our propriety“. Denn in dieser Sprache fand dies Gespräch im Tallinner Konsistorium statt. Doch prosaisch ist der Alltag: Weit verstreut liegen die evangelischen Gotteshäuser in vielen kleinen Dörfern und Weilern auf dem Land. Die Kirchen könne man nicht verkaufen – wer will sie schon haben? Sie müssen aber erhalten werden. Schließlich darf ein loser Dachziegel niemanden erschlagen.
Denn die Gebäude sind oft älteren Datums – vor der sowjetischen Besetzung des Landes 1940. Vielfach stammen sie aus der Zeit der Christianisierung der Region im 13. Jahrhundert und den Jahrzehnten nach der Reformation, die ja vor Ort wie berichtet ab 1524 erfolgte. Im 18. Jahrhundert brachten Herrnhuter und Pietisten die protestantischen Erweckungsbewegungen mit.
Allerdings liegen auch viele ländliche Gotteshäuser auffallend dezentral – noch nicht einmal inmitten der Dörfer. Öfter wurden die ersten Kirchen wohl an heidnischen Opferstätten errichtet und später an diesen Stellen – auch durch Patrone – erweitert. Oder sie lagen teils unweit alter Gutshöfe. An anderen Orten verlagerten sich durch die Neubauten während der Kolchosenzeit das Zentrum des Ortes.
Während der Sowjetzeit konnten die Gotteshäuser kaum noch instand gehalten werden. Nach 1991 und vor allem nach der wirtschaftlichen Stabilisierung gibt es Denkmalschutz auch in Estland. Doch ist dies nicht vergleichbar mit entsprechenden Zuschüssen in Deutschland bei der Restaurierung kulturell wertvoller Gebäude. Hauptsächlich sind die Kirchen in Estland für ihre Gebäude zuständig. Das Konsistorium der Evangelischen Kirche in Tallinn wurde mit Hilfe der damaligen Nordelbischen Kirche aus Deutschland renoviert. Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt Landgemeinden mit Brandschutzanlagen und einer Kirchturmsanierung.
Die Gläubigen vor Ort bezahlen ihre Seelsorgenden durch Spenden. Grundsätzlich sollten diese ein vergleichbares Gehalt bekommen wie Lehrer, fordert Viilma. Oft sind die Pfarrpersonen in drei oder vier Gemeinden tätig – allein schon, um so von ihrem Gehalt leben zu können. Dort mobil zu sein – das geht nur mit einem Auto. Oder doch lieber den Kirchturm renovieren?
Hinzu kommt: Gerade die Protestanten in Estland leben weit verstreut: „Mehr als 70 Prozent der Esten leben in Städten – aber mehr als 70 Prozent der Protestanten auf dem Land“, erklärt Urmas Viilma. Neben Tallinn und Tartu zählen auch einige Regionalzentren zu Städten. Wer mobil ist, geht zumindest dorthin. Zurück bleiben auf dem Land zumeist die Älteren. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte liegen die Dörfer dort nun nicht drei oder fünf Kilometer voneinander entfernt, sondern gut und gerne mal 15 oder 25 Kilometer.
Wie viele Gläubige gibt es?
Für wie viele Schäfchen die Geistlichen in ihren Gemeinden zuständig sind, selbst dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Denn eine feste Kirchenmitgliedschaft gibt es ebenso wenig wie Kirchensteuern. Bei der letzten Befragung, welcher Glaubensrichtung sie sich am ehesten verbunden fühlen würden, haben zwölf Prozent der Esten „protestantisch“ angekreuzt. Viilma schätzt, dass höchstens acht Prozent der Erwachsenen über 15 Jahren wirklich am Kirchenleben teilnehmen. Und vor allem bereit sind, für ihre Gemeinde zu spenden. Zukunftsmusik auch für Deutschland – mit den explodierenden Kirchenaustritten: Wie kann Erneuerung gelingen?
Wie viele Menschen in seiner Gemeinde Keila getauft sind, „weiß nur Gott“, meint auch Pfarrer Matthias Burghardt. Oft ist dies nirgends notiert – in früheren Jahrzehnten auch ganz bewusst nicht, um die Gläubigen zu schützen. Er wuchs in Niedersachsen auf und arbeitet seit 2006 in Estland. Nun ist er teilweise Pfarrer der deutschen Gemeinde in Tallinn und teils Gemeindepfarrer in Keila. Die Stadt mit 10.000 Einwohnern liegt rund 25 Kilometer westlich Tallinns. Ein Gespräch mit ihm fand nach der Reise via Zoom statt.
In Keila seien für ihn rund tausend Menschen „greifbar“, gut ein Drittel davon zahle regelmäßig an die Gemeinde, so Burghardt. Er selbst sei gut vernetzt in städtischen Gremien – er ist etwa Vorstandsmitglied im lokalen Museumsverein. Die Kirche sei denkmalgeschützt – ebenso das Pastorat. Es konnte mit Hilfe des Gustav-Adolf-Werks wieder hergerichtet werden. Dort wohnt inzwischen hauptsächlich eine
siebenköpfige ukrainische Flüchtlingsfamilie. Nachdem die Eltern Arbeit gefunden haben, bekommt die Gemeinde dafür auch Miete, so Burghardt.
Theoretisch gibt es die Möglichkeit, im Urlaub in estnischen Gemeindehäusern zu übernachten – gerade, wenn sie beschaulich liegen. Doch gestaltete sich die Kontaktaufnahme für mich schwieriger als bei der weltlichen Online-Vermittlung. Vielleicht allgemeine Überlastung der zuständigen Pfarrerinnen oder Pfarrer? So vermutet es Burghardt im Nachhinein. Sie müssten ja alles selbst organisieren – vom Sekretariat bis zur Betreuung von Senioren.