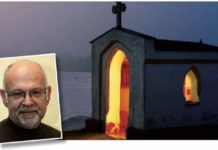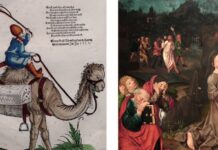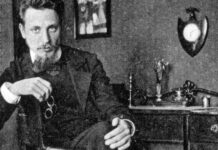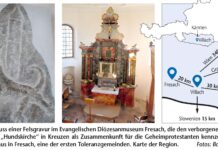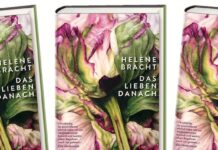Der Würzburger Theologe Huizing denkt über den Sinn des Leidensweges Jesu nach (2)
Warum lässt Gott immer wieder Leid zu – selbst in der Bibel? Allein schon in der Geschichte von Kain und Abel verhindert er nicht den Brudermord, damit die Lesenden dadurch einen Erkenntnisprozess gewinnen, wie der Würzburger Systematiker Klaas Huizing aufzeigte (vergleiche Sonntagsblatt Ausgabe vom 30. März). Nun gut, es ist eine mythische Erzählung, kein irgendwie gearteter historischer Bericht.
Das trifft für Huizing natürlich genauso auf Hiob zu – allein schon durch die Rahmenerzählung der Wette Gottes mit dem Satan. Der Gerechte leidet absolut schuldlos. Die Reden Gottes aus dem Wetter (Hiob 38) bleiben „unbefriedigend“, so Huizing. Sie bieten keinen akzeptablen Grund für Hiobs Leiden – ebenso wenig wie etwa für das Leiden von Menschen in Kriegsgebieten heute. Gott beruft sich darin auf seine Macht, die für jeglichen menschlichen Ratschluss unergründlich bleibt. Dies befreie die Menschen davon, überhaupt danach suchen zu müssen.
Denn es gilt: Hiobs „Tröstung besteht aber nicht darin, final andere Kinder und Reichtum zu bekommen“, was nicht nur auf Huizing „verstörend“ wirkt. Nein, das ursprüngliche Erklärmodell von einem „Tun-Ergehen-Zusammenhang“ wird aufgehoben. Leid kann nicht mehr als Strafe von Schuld verstanden werden, niemand muss dies mehr einfach ertragen, sondern kann aktiv Wege daraus suchen.
Hiob schweige, „weil er neue Erfahrungen macht, die verarbeitet werden wollen“ – während seine Freunde wortreich die althergebrachten Deutungen auf seine Lage anpassen wollen. Spiegelbildlich gilt allerdings auch: Ein „tugendhaftes Leben bietet nicht länger eine Garantie für freudiges und gelingendes Leben“.
Und die Passion Jesu?
Das gilt besonders für Jesus, der absolut schuldlos verurteilt wird. Doch sein Leidensweg ist die zentrale Voraussetzung für das christliche Heilsverständnis: Wenn die Deutung an Gewicht verliert, dass er die Strafe für alle menschliche Schuld auf sich nimmt oder durch sein Leiden ein Sühneopfer bietet, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn seines Leidens sowie des extrem brutalen und abstoßenden Sterbens am Kreuz neu.
Leiden und Schwäche gewählt
Auch Dietrich Bonhoeffer hat über den Sinn des Leidens Jesu nachgedacht, wobei Klaas Huizing eine Deutungslinie Wolfgang Hubers über diesen Widerstandskämpfer ausführlich zitiert: „Gott macht sich in Jesus von Nazareth die Zweideutigkeit der Welt zu eigen, nicht indem er sie aufhebt, sondern indem er sie vorbehaltlos teilt. Nicht die Versöhnung des Nichtigen mit dem Begriff der Allmacht Gottes, sondern das Vertrauen auf den Gott, der sich ans Kreuz drängen lässt und in seiner Schwachheit hilft, ist das Thema des Glaubens. … Die Teilhabe am Leiden und an der Schuld anderer ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt.“ Im tiefsten Leid und größter Schuld ist also Jesus immer schon da.
Bei seinen Annhäherungen an Jesu Passion diskutiert Klaas Huizing viele seiner Vorläufer. Viel spannender und viel erdgebundener erscheinen mir die Argumentationswege des Würzburgers dort, wo er sich direkt auf Bibelstelle bezieht.
Wie Klaas Huizing herausarbeitet, ist der gesamte Lebensweg des Gottessohnes geprägt von einem extremen Statusverzicht – getreu dem Motto „die Letzten werden die Ersten sein“. Jesu Verzicht auf Göttlichkeit, seine Geburt im Stall, Erfahrungen der Flucht nach Ägypten und des Lebens unter der ärmsten Bevölkerung (und viele ähnliche mehr) prägen seine Herkunft und seine Lebenserfahrungen.
Durch sein Leben und seine Botschaft kehrt Jesus konsequent alle bisherigen Erfahrungen von Sicherheit und Status um. In der Bergpredigt und in seinen Gleichnissen geschieht ein „bewusstes Spiel der Irritation“. Bei der Begegnung mit Jesus ein „Zerbrechen aller bisherigen Sicherheiten der Welt und Selbstbilder“.
Somit erscheint der Gottessohn in den Evangelien als „literarisches Idealporträt“, als gedankliche und emotionale Verdichtung eines Weisheitslehrers, der die bisherigen Traditionsstränge der Thora und der Prophetie neu arrangiert.
Der Lehrer als Lernender
Gleichzeitig hat Jesus auf diesem Weg selbst gelernt: Durch die kanaanitische Frau (Mt 14), die von ihm die Heilung ihrer Tochter einfordert. „Jesus zeigt sich spröde und zieht sich wie ein verknöcherter Gewerkschafter auf seine Arbeitsplatzbeschreibung zurück: Sein Aufgabengebiet beschränkt sich auf Israel.“
Er lehnt nicht nur seine Hilfe ab, sondern demütige die Frau geradezu, indem er sie auf eine Stufe mit den unreinen Hunden stellt. Sie gibt nicht auf: „Im Umgang mit lebenskundlichen Metaphern ist die Frau Jesus in dieser Situation mächtig überlegen.“ Sie lässt „Jesus den universalen Charakter der Weisheit erspüren“. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt den Anwendungsfall der Erfahrung – auch wenn dies dann Lukas überliefert.
Dieser dritte Evangelist betont immer wieder die Begeisterung über die Frohe Botschaft, wie Klaas Huizing herausarbeitet. Das ist das Gegenteil zum Spaß an gelungenen Kompetenzen der Jünger etwa beim Dämonenaustreiben (Lukas 10,17) oder an dem Vergnügen über Macht und Status. Es ist „die Vorfreude über eine alle gleich auszeichnende Gestimmtheit im himmlischen Frieden, die aber auch innerweltlich im anbrechenden Gottesreich nahe ist“. Und es ist die Freude beim Wiederfinden des Verlorenen (Lukas 15). Der Jubel beim Einzug Jesu in Jerusalem (Lukas 19).
Umkehr der Perspektiven
Wie kann das Establishment bei einem solchen Überschwang des Jubels und bei der Umkehr aller Verhältnisse die herrschende Ordnung oder das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen? „Handlungssouveränität und eine Verteidigung der Statusposition gelingt den Eliten nur, wenn sie Jesus ans Kreuz nageln lassen.“ Wohl nicht zufällig erinnert da die Wortwahl Huizings an seine Deutung der Kainsgeschichte. Doch wird diesmal die Geschichte aus der Perspektive des Leidenden erzählt. Und wiederum gilt auch hier: Adressaten dieses Umkehrprozesses sind auch die „Lesenden, die sich dabei ertappen“ wie sie selbst einen möglichst angesehenen Status gewinnen wollen oder auf die dort Erfolgreichen neidisch sind.
Um dies aufzudecken begleitet Jesus nicht nur Leidende, sondern geht selbst den Weg grenzenloser Erniedrigung bis zum Kreuz. Doch ergänzt Huizing: „Will man die Gewalt nicht gewinnen lassen, dann bleibt nur die Konsequenz, Resonanzfähigkeit über den Tod hinaus zu fordern.“
Huizing: Lebenslehre – Eine Theologie für das 21. Jahrhundert. 2022, ISBN 978-3-579-07467-2, 776 S., 38 Euro.