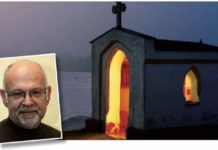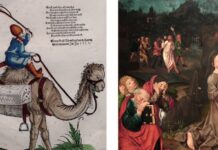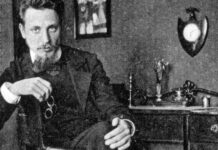Konferenz der Militärseelsorgenden diskutiert Ernstfall zwischen Himmel und „Heimatfront“
Für ihn war es keine Überraschung – jedenfalls nicht rückblickend. Brigadegeneral Gerhard Klaffus benannte für die Jahre 2014 und 2022 Faktoren in Westeuropa, die den Eindruck von Schwäche und eines Kreisens um sich selbst hinterlassen konnten. Damit setzte er in seinem Vortrag vor der Konferenz der Evangelischen Militärseelsorgenden in Nürnberg Akzente. Vor acht Jahren griff Putin den Donbass und die Krim an sowie Anfang 2022 den Rest der Ukraine.
Erinnern wir uns: Anfang 2022 stand die Ampelkoalition gerade in den Startlöchern, während Frankreichs Präsdient Macron ab April 2022 um seine Wiederwahl kämpfen musste: Das war knapp. Es gab Uneinigkeiten bei Corona-Lockerungen. Der Westen war noch mit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan und zunehmenden Konflikten in Mali, Niger und Burkina Faso beschäftigt. Schon 2014 hatte sich dort die fragile Lage abgezeichnet, die dann weiter eskalierte.
So weit, so bekannt. Beunruhigend sind aber die Schlussfolgerungen, die der Brigadegeneral – als deutscher Militärischer Vertreter beim Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in Europa in Belgien (Englische Abkürzung: SHAPE) – daraus für die Zukunft zog: Turnusgemäß steht in vier Jahren wieder eine Bundestagswahl an, direkt gefolgt von Wahlen in Großbritannien im Frühjahr oder spätestens im Sommer 2029. Auch ein Regierungswechsel in den USA wäre turnusgemäß zu erwarten. Klaffus ging gar nicht darauf ein, dass ja da auch eine noch viel beunruhigendere Möglichkeit denkbar ist: Nämlich, dass die Wahlen dann vielleicht da ausgesetzt werden könnten.
Dafür richtete er den Blick gen Süden: Verschiedene Krisenherde in Afrika und im Nahen oder Mittleren Osten haben für ihn das Potential zu gegebener Zeit wieder aufzuflammen – ein Funke genüge. Auch der Einwanderungsdruck aus Afrika werde steigen – allein schon, weil sich dort die Bevölkerung bis 2050 verdoppeln wird, während gleichzeitig immer größere Gebiete klimatisch unbewohnbar werden oder zumindest keine Nahrung mehr hervorbringen.
So hält es der General nicht für unwahrscheinlich, dass 2029 „Russland die NATO testen könnte wie 2014“. Er ergänzte: „Je kleiner die Zumutung ist, desto unwahrscheinlicher wird eine volle Gegenreaktion“ des Westens. Wollen westeuropäische Staaten dies zulassen oder sich verteidigen? Ab wann? Seine Konsequenz: „Deutschland muss resilienter werden – und entschlossener.“
Verteidigung der Werte
„Resilienz“, das war ohnehin ein Begriff bei der Konferenz der Evangelischen Militärseelsorgenden, auf den niemand lange zu warten brauchte. Nicht nur die Bundeswehr müsse handlungsfähig sein, sondern auch die Zivilgesellschaft. Professor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München betonte bei der Konferenz, dass es beim russischen Angriff nicht allein um Territorien gehe, sondern um die Frage, welche Weltordnung und welche Werte künftig gelten sollen. „Die eigentliche Zeitenwende steht noch bevor“, so Masala.
Masala hob die Rolle gesellschaftlicher Institutionen wie der Kirchen hervor. Die Militärseelsorge sei entscheidend, um seelische Stabilität in Krisenzeiten zu sichern. Gerade in Extremsituationen brauche es Vertrauenspersonen, die begleiten und unterstützen – für die Truppe wie für die Gesellschaft insgesamt.
Der Evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg will die Militärseelsorgenden auf den Verteidigungsfall „handlungsfähig“ vorbereiten (vgl. das Interview mit ihm vergangene Ausgabe). Er will dazu „Rahmenkonzept Seelsorge und Akutintervention im Spannungs- und Bündnisfall“ weiter voranbringen. Dieses soll ein vernetztes und ökumenisches Handeln der Seelsorgenden im Verteidigungsfall ermöglichen und im Juni in der Kirchenkonferenz der EKD zur Diskussion stehen – um ein konkretes Handlungskonzept zu entwickeln, das bis „auf die Ebene von einzelnen Kirchengemeinden“ reiche. Die Bereitschaft, sich diesen Fragen zu stellen, nehme in den Landeskirchen zu.
Felmberg rechnet damit, dass Seelsorgende künftig auch in Krisensituationen vor Ort sein werden: an der Seite von Verwundeten, Gefangenen oder Traumatisierten – während möglicherweise zu Hause ebenfalls Notlagen entstehen.
Neben klassischer Kriegsführung rücken neue Formen der Bedrohung in den Vordergrund. Vizeadmiral Thomas Daum, zuständig für Cyberabwehr und Informationssicherheit, warnte vor digitalen Angriffen auf die Strom- oder Wasserversorgung. Ferner fragte er, ob hierzulande dieselbe Resilienz herrsche wie in der Ukraine, wenn allein digital das Strom- oder Wassernetz lahmgelegt würde.
Ethische Herausforderung
Auch autonome Waffensysteme – etwa Drohnen, die eigenständig töten können – werfen drängende ethische Fragen auf. Keine Zukunftsmusik mehr, sondern etwa in der Ukraine nach Daum nur noch „eine Frage von Monaten“. Kann sich eine Demokratie diese moralischen Diskussionen leisten, wenn autoritäre Systeme längst handeln? Oder verraten wir nicht so schon Werte?
Daum bestätigte die wichtige Rolle der Militärseelsorge durch ein Beispiel, das schon beinahe vier Jahre zurückliegt. Bereits bei der Flut im Ahrtal hatten Bundeswehrangehörige angeschwemmte Leichen bergen müssen. Was gab ihnen dafür die Kraft? Allein die Tatsache, dass Militärgeistliche „mit dabei“ waren.
Offene Fragen
Solche und weitere Horrorszenarien standen zur Diskussion bei der Tagung der Militärseelsorgenden. Sicher wird niemand mehr Waffen „für das Vaterland“ segnen. Aber bald für die Demokratie? Niemand will einen Krieg herbeireden, auch das wurde deutlich – auch nicht in vier Jahren.
Aber trotz des strahlenden Sonnenscheins, der auch in die abgedunkelten Räume eindrang und trotz aller Osterhoffnung – kommt er irgendwann so unvermeidlich wie aktuell autonome Drohnen? Was wollen wir? Und was sind wir bereit, dafür zu riskieren? Die Debatte beginnt jetzt – nicht erst im Ernstfall.