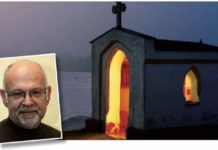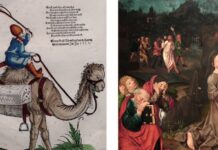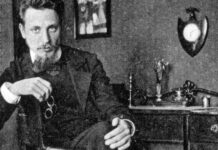Editorial zum 50-jährigen Jubiläum der KSZE-Schlussakte von Chefredakteurin Susanne Borée
Aus christlichen Werten entstanden Hoffnungszeichen: Vor 50 Jahren, am 1. August 1975, wurde in Helsinki ein Abkommen unterzeichnet, dessen Geist bis heute besteht. Und dies mit dem sehr technischen und nichtssagenden Titel „KSZE-Schlussakte“! Inmitten des Kalten Krieges einigten sich die Länder Europas und Nordamerikas östlich und westlich des Eisernen Vorhangs erstmals offiziell auf die Unverletzlichkeit von Grenzen, die friedliche Streitbeilegung und die Achtung der Menschenrechte. Ein klassisches diplomatisches Tauschgeschäft – dessen Geist eine unerwartete Sprengkraft erfuhr.
Die Sowjetunion fühlte sich zunächst als Sieger der Vereinbarung: Ihr Eindringen nach 1945 etwa im Baltikum, die Grenzverschiebungen in Polen, die Errichtung der DDR wurden anerkannt.
Gleichzeitig entfaltete das Bekenntnis zu Grundfreiheiten eine langfristige Wirkung. Besonders die garantierte Religionsfreiheit verwandelte die Kirchen in der DDR oder in Polen zu Orten der Hoffnung. Christliche Werte wie Gerechtigkeit und die Ansprüche der Bergpredigt fanden neuen politischen Widerhall.
Die Veröffentlichung des Vertragstextes in Staatsmedien wie der sowjetischen „Prawda“ ermöglichte etwas bis dahin Undenkbares: Menschen beriefen sich nun auf ihre verbrieften Rechte. Zahlreiche „Helsinki-Gruppen“ in der Sowjetunion und in Osteuropa entstanden. Für ihren Einsatz gegen Repression und Willkür konnten sie sich nun auf das Abkommen berufen. Bald schon wurden sie wieder verfolgt. Doch langfristig bereiteten sie den Weg für Freiheit und Selbstbestimmung
Michail Gorbatschow begab sich selbst auf den Weg von Frieden, Fortschritt und Menschenrechten. Doch die Wirtschaftskrisen und das Chaos der 1990-er Jahre in Russland stoppten diesen Aufbruch. Wladimir Putin deutete bald den Zusammenbruch der Sowjetunion als eine Folge der Verschwörung ihrer Feinde und eine Niederlage ihrer Heimat.
Er setzt nun auf Aggression nach innen und nach außen. Unter dem Anspruch christliche Werte in seinem Reich zu schützen, tritt er die Botschaft Jesu mit Füßen: Der Geist von Helsinki soll endgültig sterben. Doch Irina Scherbakowa, Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, beschreibt aus dem deutschen Exil ihre Hoffnung, dass „die Wiederbelebung Russlands, wenn sie denn jemals möglich sein könnte, mit der Wiederbelebung dieses Geistes beginnen wird.“