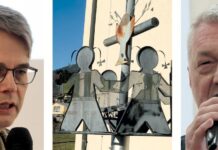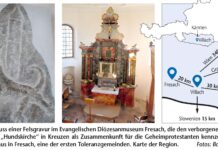Editorial im Evangelischen Sonntagsblatt aus Bayern über Grenzerfahrungen
„Werden wir an der Grenze Zeit verlieren?“ Diese Frage stellten wir uns vor unserem Urlaub auf dem polnischen Ostseeküsten-Radweg von Danzig zurück nach Usedom. Denn seit Monaten häuften sich die Meldungen über verschärfte Kontrollen im Osten. Die Realität war unspektakulär: Der Zug fuhr an der Grenze nur etwas langsamer.
Und zurück auf dem Europa-Radweg entlang der Ostsee hinter Swinemünde war die Grenze zwar markiert, doch standen dort nur auf polnischer Seite drei Grenzer in ein Gespräch vertieft. Nun gut, wir haben jetzt nicht stundenlang auf einen Einsatz dort gewartet, doch waren viele Radler mit schwerem Gepäck unterwegs.
Also leere Symbolpolitik, da wohl kein professioneller Schlepper die allzu bekannten Autobahnen mit den Checkpoints nehmen wird? Wollen diese nur Bilder erzeugen, die Stärke demonstrieren sollen, während sie zugleich den Eindruck von Staus und Stillstand vermitteln?
Zumindest weckten sie in mir Erinnerungen: Schließlich bin ich unweit der Grenze zu den Niederlanden groß geworden. Als ich als Grundschülerin mit meinen Eltern dorthin unterwegs war, fiel erst bei der Rückkehr auf, dass sie meinen Kinderausweis nicht dabei hatten. „Dann muss das Mädchen wohl hier bleiben“, lachten die Grenzer. Ich fand es nicht witzig. Noch lange nach Schengen hatte ich bei Radfahrten gen Westen meinen Perso dabei – da die Grenze oft nicht klar erkennbar ist.
Als DDR-Grenzer nach dem Berliner Kirchentag im Sommer 1989: demonstrativ langsam kontrollierten, zeigten Sie ihre Macht, die da bereits auf tönernen Füßen stand. Als wir Anfang 1990 Thüringen entdeckten, winkten sie seufzend ab: „Das ist jetzt auch egal.“
Die Kontrollen zeigen Macht – gerade jetzt zehn Jahre nach dem „September 2015“. Doch solange sie nicht flächendeckend sind, ließe sich das Geld dafür überall sinnvoller ausgeben. Und wir wollen ja wohl nicht zu DDR-Verhältnissen zurückkehren!
Wollen wir wirklich, dass unsere Kinder wieder mehr Abgrenzung lernen? Schließlich kann mein Sohn sich kaum noch vorstellen, dass etwa Österreich nicht „schon immer“ zu Europa gehörte, sondern erst 1995 der EU beitrat. Es zeigt, wie fehlende Schlagbäume und Sprachbarrieren, mit denen man auch nach dem Abbau der Grenzzäune ansonsten zu kämpfen hat, Verbindung schaffen. Da haben wir mehr zu verlieren als nur unsere Zeit!