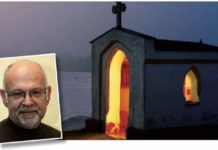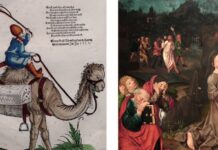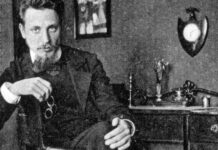Editorial im Evangelischen Sonntagsblatt aus Bayern über Sternbilder von Chefredakteurin Susanne Borée
Leider war es in vielen Nächten dieses Altweibersommers allzu oft von dicken Regenwolken verborgen – mein neues persönliches Sternbild: der Große Schutzengel. Es begleitet mich seit dem Poetenfest in Erlangen, an dem ich erfahren habe, wie willkürlich die Bilder sind, die wir in den Sternen sehen.
Eigentlich war ich dort Ende August zu Lesungen von Autoren, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind und die bald sicher mehr von sich hören lassen. Auch Gespräche und Diskussionen zu komplexen gesellschaftlichen Themen gab es, die etwa die ganze Problematik des Nahen Osten klären konnten. Nachdem dies jedoch real schwieriger scheint denn je, ich aber in meinem Urlaub oft zu den Sternen aufschaute, nun also zurück zu ihnen.
In Erlangen also geriet ich mehr zufällig in einen Vortrag von Raoul Schrott: Er sammelte Sternbilder aus 17 Kulturen bis hin zu den Aborigines. Nichts für mich, bin ich doch astrologische und astronomische Analphabetin! Trotz aller Bemühungen meines Vaters in meiner Kindheit gelangte ich nur bis zum Großen Wagen nebst Polarstern. Weiteres fand ich zu weit hergeholt.
Ich hatte Recht: Selbst der Große Wagen war für die Maya ein Papagei, für die Inka ein Gewittergott, für die Inuit ein Elch, für die Araber eine Totenbahre, so Schrott. Unsere Version ging von Babylon über die Griechen, die Römer und Araber – oft neu gelesen und gefüllt.
Immer aber geleiteten Sterne die Menschen durch Raum und Zeit im Jahreszyklus. Mehr noch: Wenn sie klar zu sehen waren, war die Luft meist trocken – mit Folgen für das Wachstum der Natur. Keine Kausalität, aber mit gemeinsamen Ursachen – auch wenn alle 17 Kulturen das anders sahen.
Raoul Schrott erkennt noch weitere Zusammenhänge: Alle 17 sehen da oben Figuren zu Legenden, die für sie zentral waren: oft Schöpfungsmythen, die so regelmäßig über den Köpfen der Menschen erschienen. Und Erklärungen „wie die ersten Wesen der Welt in den Himmel gelangten“, um sich seitdem immer wieder dort zu zeigen.
Diese Ideen müssen entstanden sein, bevor es die Aborigines nach Australien verschlug, so Schrott. Also vor 40.000 bis 60.000 Jahren. Erst danach starben die Neandertaler aus. Ein gemeinsames Erbe der Menschheit, das diese damals schon weitergaben – und zwar offenbar nachhaltiger als mein Vater an mich? In diesen Nächten vor Michaelis jedenfalls bevorzuge ich meinen großen Schutzengel am Firmament.