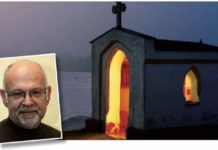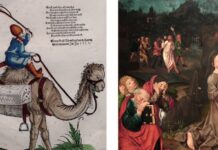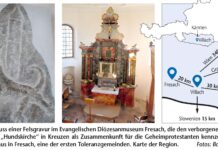Religiöses Ringen Thomas Manns zum 150. Jubiläum zwischen Riten, Reue und Rettung
Es ist die Karikatur eines Weihnachtsfestes: In seinem Erstlingswerk „Buddenbrooks“ inszeniert Thomas Mann (1875–1955) um die Jahrhundertwende den Heiligen Abend als sorgfältig arrangiertes und detailreiches Schauspiel bürgerlicher Repräsentation sowie familiärer Ordnung. Doch gleichzeitig offenbart seine Darstellung, wie weit diese Rituale vom Stall und Stern von Bethlehem entfernt sind. Der Kult bleibt erhalten, doch seines lebendigen Kerns beraubt.
In ironischem Ton wirkt das Weihnachtsfest wie ein Abgesang auf das Christentum: die Rituale sinnentleert, die Moral bigott, die kirchlichen Amtsträger als Karikaturen ihrer selbst. Gott wird hier zum Götzen der Geschäftsinteressen, der in der strengen Ordnung und der wirtschaftlichen Rationalität der Familie seinen Platz findet.
Eine umfassende Betrachtung von Thomas Manns Verhältnis zur Religion bietet der emeritierte katholische Tübinger Professor für Ökumenische Theologie, Karl-Josef Kuschel, in seinem Werk „Weltgewissen“, das zum 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers erschien. Er zeigt, dass der Schriftsteller weit über die Kritik in den Buddenbrooks hinausging.
Schon früh verschafften Mann die Musik Richard Wagners oder das Denken Nietzsches und Schopenhauers existenzielle Erfahrungen fast religiöser Dimension. Das Grauen vor dem Tod, das Staunen über die Naturgewalten und die tiefgreifende Erschütterung durch Liebeswirkungen prägten den jungen Mann stärker als Bibel oder Gottesdienste.
Sein Roman „Der Zauberberg“ von 1924, den Mann selbst als „ein religiöses Buch“ bezeichnete, vertieft diese Auseinandersetzung. Das Sanatorium wird zur säkularisierten „Zwischenwelt“, in der Krankheit, Tod und Zeitlichkeit religiös interpretiert werden. Die Hauptfigur Hans Castorp erlebt sein Leiden, die Versenkung in Musik und die Begegnungen mit Weggefährten als Wege zu einer säkularen Form von Transzendenz. Er sucht nach dem Sinn seiner Existenz in einem unüberschaubaren Kosmos und buchstabiert jenseits der christlichen Tradition die alten Fragen von Tod, Erlösung und Hoffnung durch.
Wert(e)-voller Widerstand
Mit der Bedrohung durch den Nationalsozialismus wandelte sich Thomas Manns Haltung deutlich. Er erhob öffentlich seine Stimme gegen die „Verrohung des Sittlichen“ und entdeckte christliche Werte neu als geistiges Gegengewicht gegen die zerstörerische Kraft der ideologischen Systeme im Faschismus. Das Christentum verstand er nun als innere Haltung, die verantwortliches Handeln ermöglicht und Orientierung im Streben nach dem Guten bietet. Es begründet so den Humanismus religiös.
Thomas Manns Haltung zum Judentum blieb dennoch zwiespältig. In seinen Werken und tagespolitischen Äußerungen finden sich bis weit in die Zeit des Holocaust antisemitische Stereotypen, obwohl seine Frau Katia aus einer jüdischen Familie stammte. Gleichzeitig zeigt sich besonders in der Exilzeit eine klare Parteinahme für das Judentum.
Biblische Mythen betrachtete Mann als „Zeugnis kondensierter geschichtlicher und kultureller Erfahrung“. Zwischen 1927 und 1943 setzte er sich in seinem vierbändigen Werk „Joseph und seine Brüder“ intensiv mit dieser Überlieferung auseinander. Er lässt darin Joseph mit dem Pharao Echnaton zusammenarbeiten, während dieser in der Bibel ungenannt bleibt. Doch Echnaton versuchte bereits Mitte des 14. vorchristlichen Jahrhunderts eine alleinige Verehrung des Sonnengottes Aton durchzusetzen. Das geschah gegen die Interessen der Priesterschaft, die dieses nach dem plötzlichen, vielleicht gewaltsamen Tod des Pharaos zurückdrehten. Thomas Mann gestaltet in dem Roman den Gegensatz zwischen einem weltfernen und vorübergehenden Sonnenkult und dem lebensdienlichen, geschichtlich verankerten Gott Israels. Damit entfaltet der Dichter die Frage, wie religiöse Traditionen existenziell und kulturell wirksam werden und welche Bedeutung sie zukunftsfähig in der menschlichen Erfahrung entfalten.
Nach 1945 fasst Mann zusammen: „Religion ist Ehrfurcht“ gegenüber dem Leben, das an das Absolute zurückgebunden wird. Sie achtet Recht, Vernunft und Menschenwürde, und kann sich nur in einer demokratischen Gesellschaft voll entfalten.
Neuer Gewinn der Gnade
In seinem letzten Lebensjahrzehnt tritt das Religiöse in Manns Werk immer deutlicher hervor. Krankheit, Alter und Rückblick führen ihn zu existenziellen Auseinandersetzungen mit Schuld und Rechtfertigung. Die Sehnsucht nach Gnade wird zu einem zentralen Motiv, etwa in der Gregoriuslegende („Der Erwählte“).
Und im „Doktor Faustus“ von 1947, der vom Teufelspakt des Musikers Adrian Leverkühn erzählt: Das verschafft ihm kreative Genialität im Stil Wagners, zerstört aber zugleich seinen moralischen Anstand. Leverkühn isoliert sich zunehmend, erlebt innere Leere und verkörpert zugleich die Krise Deutschlands sowie die Katastrophe der Nazizeit.
Thomas Mann reagiert hier indirekt auf den Roman „Mephisto“ seines Sohnes Klaus von 1936, erweitert das Thema aber zu einer tiefgreifenden metaphysischen Parabel über Schuld, Hochmut, Verfall – und Gnade. Diese erfährt Leverkühn über die treue Anteilnahme des Freundes Serenus Zeitblom, der ihm engelsgleich Schuld und Begrenztheit aufzeigt – aber ohne direkte Gottesbegegnung.
Insgesamt spricht auch der späte Thomas Mann nicht von einem personalen Gott, sondern von Gnade als „souveränste Macht“ oder höchstens als „Helferin“. Karl-Josef Kuschel bezeichnet ihn daher als „religiös empfindenden Zweifler“ – einen Denker, der das Zentrum protestantischer Theologie, die Rechtfertigungslehre, tief erfahren hat – und zwar als existentielles Fragen: Wie lebt man mit Schuld? Wie kann man sie tragen – oder ablegen? Thomas Mann umkreist das Heilige, ohne es direkt anzusprechen – aus Respekt vor dem Unverfügbaren und weil er das religiöse Vokabular als „verbraucht“ empfindet, so Kuschel.
Für ihn steht das Werk Manns im Vordergrund. Doch dieser musste auch den Suizid von zwei Schwestern sowie des Sohnes Klaus 1949 erleben. Auch Tochter Erika war literarisch hochbegabt, aber labil und suchtkrank. Im autobiografischen Essay „Meine Zeit“ von 1950 empfindet der immer sehr gewissenhaft arbeitende Schriftsteller Mann sein Leben als heilungsbedürfig. Somit sei es wie auch seine Bücher tief christlich. Selbst das beste Werk reiche nicht aus, jedes Leben werde auf Kosten anderer geführt. Zwar sehnte er sich nach verbindlichem Glauben, die Schwelle überschritt er jedoch nie, deutet Kuschel. Thomas Mann war kein Bekenner. Aber er war ein Erzähler der Gnade.
Karl-Josef Kuschel: Weltgewissen: Religiöser Humanismus in Leben und Werk von Thomas Mann, Patmos-Verlag 2025, 448 Seiten, 46 Euro, 36 Euro als E-Book, ISBN 978-3-8436-1589-1.