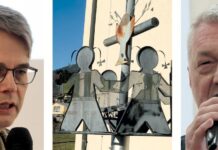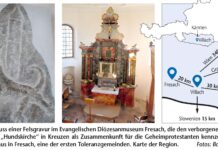Kleine Schwestern der „Alten Brücke“ in der Ex-Frontstadt Mostar überwinden Abgründe
„Wir feiern alle religiösen Feste zusammen.“ Der Satz von Kindergartenleiterin Aida Kaja klingt schlicht – und ist doch etwas ganz Besonderes. Im Kindergarten „Sunčani most“, der „Sonnenbrücke“ in Mostar, leben Kinder seit über zwanzig Jahren, was im Alltag Bosnien-Herzegowinas ansonsten kaum gelingt: Sie lernen, spielen und feiern miteinander, unabhängig von Herkunft oder Religion. Unter dem Motto „Kleine Träume in sicheren Händen werden zu großen Geschichten“ entdecken hier 40 Kinder gemeinsam ihre Welt.
Tief eingeprägte Teilung
Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt ein Blick in die Gesellschaft. Der Krieg, der vor 30 Jahren mit dem Abkommen von Dayton endete, hat bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben und katholische Kroaten leben in aller Regel streng getrennt voneinander. Kinder besuchen oft Schulen, die zwar im selben Gebäude liegen, aber verschiedene Eingänge, Pausenzeiten und Lehrpläne haben.
Eine Interreligiöse Studien- und Begegnungsreise nach Bosnien-Herzegowina führte 20 Teilnehmende aus Bayern zu intensiven Gesprächen und Erfahrungen auf den Balkan. Pfarrerin Mirjam Elsel organisierte dies als Beauftragte für interreligiösen Dialog der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum 30-jährigen Kriegsende zusammen mit muslimischen Repräsentanten.
In Mostar, der größten Stadt Herzegowinas, konnte die Gruppe erleben, was Trennung bedeutet. Die Stadt, übersetzt „Brückenwächter“, wurde im Krieg selbst zum Symbol der Teilung. Die berühmte „Alte Brücke“ fiel 1993 gezieltem Beschuss zum Opfer. Von den rund 127.000 Einwohnern im Jahr 1991 waren damals 35 Prozent Bosniaken, 34 Prozent Kroaten und 19 Prozent Serben. 2013 war die Bevölkerung auf 113.000 Menschen geschrumpft, davon 48 Prozent Kroaten, 44 Prozent Bosniaken und nur noch vier Prozent Serben. Sie leben in streng getrennten Stadtteilen – vom Fluss geteilt. Erst 2004 wurde die Brücke unter Federführung der UNESCO wieder aufgebaut – doch viele Gräben blieben.
Die „Sonnenbrücke“ für die Kleinen entstand 2002 getragen vom Österreichischen Diakoniewerk. Seitdem haben rund 500 Kinder dort miteinander gespielt, Geschichten geteilt und Freundschaften geschlossen. 2021 bezog der Kindergarten sein heutiges Haus etwas abseits vom Zentrum, aber mit Garten – ein Ort, der Ruhe und Sicherheit ausstrahlt.
Aida Kaja, selbst Muslima, leitet das Team seit drei Jahren. Ihr Sohn besuchte die Einrichtung vor 13 Jahren – eine Erfahrung, die sie prägte. Heute arbeitet sie mit fünf Kolleginnen aus den verschiedenen Volksgruppen zusammen. „Jede bringt die eigenen Traditionen mit – und teilt sie mit allen Kindern“, sagt sie. Gemeinsames Feiern, auch in der Weihnachtszeit, Ausflüge und Elternbegegnungen sind Alltag.
Inklusion als Alltag
Ein Schwerpunkt der Einrichtung ist Inklusion. Viele Kinder benötigen
logopädische, ergotherapeutische oder entwicklungsbegleitende Unterstützung. Eigene Räume ermöglichen Rückzug oder konzentrierte Therapieeinheiten. Externe Fachkräfte ergänzen das Team. Der Bedarf wächst, sagt Kaja: Auch Kinder ohne offiziellen Förderbedarf bräuchten oft ebenfalls gezielte Unterstützung.
Wichtig ist ihr, dass sieben der 40 Kinder kostenlos betreut werden können. Hundert Euro kostet ein Platz im Monat – viel Geld in einem Land, in dem das durchschnittliche Einkommen bei 700 Euro liegt. Bewegt erzählt Kaja von einer Familie, der der Strom abgeschaltet wurde. Die Eltern der anderen Kinder sammelten spontan Geld und halfen. Solche Momente zeigen, wie sehr die „Sonnenbrücke“ Familien verbindet.
Die Nachfrage ist riesig. Jedes Jahr gäbe es eine lange Warteliste, denn die Stadt biete selbst nur wenige Kita-Plätze an. Und private Einrichtungen sind oft unbezahlbar.
Umso wichtiger ist auch das zweite Standbein der Arbeit: mobile Förderung. Nach der Corona-Zeit wurden viele Gesundheitsangebote drastisch gekürzt. Um diese Lücke zu schließen, besuchen Teams von „Sunčani.mobil“ andere Kindergärten, Schulen oder Familien. Rund 60 Kinder, meist aus benachteiligten Familien, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mit herausfordernden Verhalten, erhalten Unterstützung und therapeutische Begleitung. Eltern lernen, wie sie mit einfachen Hilfsmitteln die Entwicklung ihrer Kinder stärken können.
Traumata vor Ort angehen
Doch die Herausforderungen reichen über die frühe Kindheit hinaus. Viele tragen noch die Folgen unverarbeiteter familiärer Kriegserfahrungen in sich – und treffen in Schulen auf Lehrkräfte, die selbst traumatische Erlebnisse mit sich tragen. Hier setzt der Verein „Progres“ an, der 2010 in Sarajevo gegründet wurde.
Im Zentrum der Arbeit steht die Frage, wie Schulen Orte werden können, in denen Kinder Sicherheit erfahren und Beziehungen wachsen können. Mit Hilfe der deutschen Stiftung „Wings of Hope“ wurden 20 Fachkräfte aus dem Bildungs- und Sozialbereich qualifiziert: Viele von ihnen kennen Verlust, Flucht oder Trennung aus ihren Familien.
Projektkoordinatorin Sanja Čović beschreibt die Weiterbildung als „gemeinsame Lernreise“. Für viele habe es Mut gebraucht, sich mit eigenen Erfahrungen und der weitergegebenen familiären Belastung auseinanderzusetzen. Der Austausch schuf Vertrauen – etwas, das im Alltag oft fehlt. Besonders berührend war für sie die Zusammenarbeit zweier Lehrkräfte aus den getrennten Stadtteilen Mostars. Heute planen sie ein gemeinsames Projekt für ihre Schulen. Ein weiterer kleiner Schritt, um in dieser Stadt Trennlinien zu überwinden.
Daneben stärkt „Progres“ lokale Gemeinschaften durch die Vernetzung von Schulen, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Ziel ist es, Jugendlichen Perspektiven zu eröffnen, Bildungsreformen anzustoßen und praktische Fähigkeiten zu fördern. „Wir wollen Menschen stärken, die den Mut haben, Brücken zu bauen“, sagt Čović – im Unterricht oder in ihren Familien.
Leider hat die deutsche Bundesregierung aktuell massiv die bisherigen Mittel für „Pogres“ gekürzt. Viele Projekte, die Stabilität und Hoffnung schaffen, stehen dadurch auf wackeligen Füßen. Umso wichtiger bleibt die lokale und internationale Zusammenarbeit, die „Progres“ über Jahre aufgebaut hat – getragen von der Überzeugung, dass Versöhnung durch Begegnung am besten gelingt.
In der „Sonnenbrücke“, in mobilen Therapieteams und in den Schulen des Landes wächst diese Begegnung bereits – Schritt für Schritt, festgehalten in vielen kleinen Geschichten des Miteinanders.