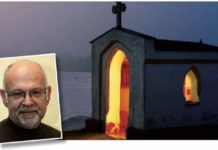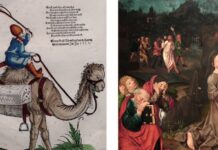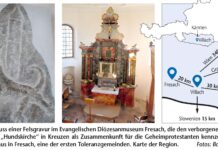Wie Avatare das Gedenken zwischen Sehnsucht, Simulation und Selbstbild verändern
Wollte sie mit ihm Kontakt aufnehmen? Auf ein Selbstporträt des amerikanischen Fotographen William H. Mumler schmuggelte sich bereits um 1860 eine verschwommene Frauengestalt. Sie war gar nicht bei der Aufnahme dabei gewesen.
Zunächst glaubte Mumler darin den Geist seiner verstorbenen Cousine zu erkennen: Wollte sie mit ihm über das magische Medium der Fotoplatte in Verbindung bleiben? Nach dem ersten wohligen Grusel erkannte der Profi: Es war eine versehentliche Doppelbelichtung einer Fotoplatte, die er nicht gründlich gereinigt hatte.
Kein Porträt einer Toten, dafür die Geburt einer Geschäftsidee. Mumler konnte nun „Geisterfotografien“ beliebig reproduzieren. Er fand bald weitere Möglichkeiten, sie spektakulär ins rechte Licht zu rücken: Durch die langen Belichtungszeiten erschienen Personen, die kurz in den Bildraum hineintraten, nur schwach sichtbar und verwischt auf dem Foto.
Für heutige Augen sehen die Resultate nicht wirklich überwältigend aus. Doch sie faszinierten Mumlers Kunden. Da stellt sich heute bei schier realistischen Gesprächen mit Avataren die Frage: Überfordern wir uns nicht selbst mit diesen Geschöpfen?
„Menschen sind nicht voll rationale Wesen“, sagt Karsten Weber, Professor für Ethik in der Informationsgesellschaft an der Hochschule Regensburg. Der Philosoph und Informatiker forscht zu Fragen der Technikfolgenabschätzung. Im Zoom-Interview mit dem Sonntagsblatt denkt er über diese Form der Erinnerungskultur nach.
Gerade in solch sensiblen Bereichen, so Weber, können Emotionen leicht die Oberhand gewinnen. „Wir fühlen uns wohler, wenn wir die Faktenlage außer Acht lassen.“
Trauerarbeit mit Avatar
Ein heutiger digitaler Zwilling behauptet längst nicht mehr der Verstorbene selbst zu sein. Wir wissen zumindest ungefähr, wie er zu seinem Erscheinungsbild gekommen ist. Doch wenn ein Hinterbliebener vor einem Bildschirm sitzt und mit einer vertrauten Gestalt spricht, dann verschwimmen Realität und Illusion. Noch treten solche Avatare hierzulande sehr vereinzelt auf. Daher gibt es bislang seines Wissens keine empirischen Studien zum Umgang mit digitalen Zwillingen, so Weber. Erste Beobachtungen deuten aber für ihn darauf hin, dass die intensive Beschäftigung mit ihnen die Trauerarbeit stören könnte.
Vor allem bei einsamen Hinterbliebenen sieht er die Gefahr, dass der Avatar zur Flucht aus der Realität verhilft – „eine Art Auffangnetz“: Es federt den Schmerz ab, aber verhindert auch seine Verarbeitung. Er wird zu einer weiteren Methode den Verlust, den Tod zu verdrängen. Darin ist unsere Gegenwart sowieso gut.
So sieht Weber mehr die Risiken und Grenzen der Avatare. Seine Kollegin Katrin Döveling, Medienpsychologin an der Darmstädter University of Applied Sciences, kann aber auch Chancen dieser Entwicklung erkennen. Beim Telefonat mit dem Sonntagsblatt meinte sie: Der Avatar bietet verstärkt neue Möglichkeiten, um die Trauer auszuleben, anstatt nach kurzer Zeit wieder so zu funktionieren als sei nichts gewesen.
Trauer sei kein linearer Prozess, sondern ein Wechselspiel von Phasen, in denen Verlustgefühle dominieren, und zukunftsgewandten Zeiträumen: Dann lernen die Hinterbliebenen, ein neues Leben aufzubauen und die Beziehung zur verlorenen Person umzudeuten. Gerade zu Jahrestagen, Geburtstagen oder bestimmten Feiertagen haben sie oft besonders stark das Bedürfnis, sich an die verstorbene Person zu wenden und vielleicht Unerledigtes zu klären.
Dabei, so Döveling, könne KI unter Umständen vorteilhaft sein. Der Avatar biete Trauernden noch einmal die Möglichkeit loszuwerden, was man auf dem Herzen habe – wenn auch in einem symbolischen Akt. Versöhnung kann ohnehin zuallererst mit mir selbst erfolgen nicht mit dem anderen.
Natürlich sieht auch sie die Gefahr, dass ein digitaler Zwilling das Weiterleben des Verstorbenen simuliert und ein Abschiednehmen hinauszögert. Illusionen erscheinen real. Aufklärung sei hier besonders wichtig.
Sicher könne die Arbeit am Avatar ein Prozess intensiver Biografiearbeit sein „wenn man es ernst meint“, ergänzt auch Weber. Doch besteht da die Versuchung, Erinnerung in den hellsten Farben zu inszenieren. Und das Gegenüber des Avatars objektiviert die Erinnerung, schreibt sie fest. „Am Grab geschieht Erinnerung je nach den eigenen Bedürfnissen“, setzt er dagegen. Und kein Porträt gewinnt ohne Schatten an Tiefe.
Genauso helfen Fotos von Verstorbenen, Erinnerungen zu vergegenwärtigen. Aber auch sie schreiben oft Situationen fest, die uns besonders erinnerungswürdig erscheinen. Die meisten Menschen inszenieren sich da gerne ausgelassen und glücklich. Entfaltet dies am Ende wirklich Trost?
Geschäftsmodell Gedenken
Wo Emotionen stark sind, ist das gute Geschäft meist nicht weit. Das wusste auch William H. Mumler vor gut 150 Jahren: Auf seinem Meisterwerk ließ er den bereits ermordeten Abraham Lincoln hinter seine Witwe treten, wobei er ihr tröstend die Hände auf die Schultern legte.
Skeptiker klagten den Fotografen schon bald wegen Betrugs an. Doch Mumler gewann souverän die Prozesse: Wer sein Vorgehen technisch begriff, der schwieg und ahmte seine Idee nach. Gerade im angelsächsischen Raum gab es bald Dutzende Nachfolger, die immer ausgefeiltere Retuschierungsverfahren ersannen.
Damals bestand zumindest noch nicht die Gefahr von Monopolbildung. Bislang galt in der analogen Welt professioneller Erinnerungsarbeit: Es gab viele Anbieter für Nachrufe und Biografien. Dagegen könnten bei Avataren auch bald wenige große Tech-Plattformen den Markt beherrschen. Je realistischer der Avatar erscheint, je mehr „Erinnerungen“ er hat, desto mehr kostet er. Nach einer Einrichtungszahlung folgen monatliche Abo-Gebühren für die digitale Präsenz – bis Opa schließlich in der Erinnerung bleibt als der Grund für die nächste Abbuchung.
„Kostenlose“ Angebote sind umso riskanter: Hier besteht die Gefahr, dass persönliche Daten missbraucht werden oder in falsche Hände geraten. Ohnehin ist es eine Illusion, „privat“ mit dem Avatar zu reden, ohne dass die Tech-Firmen es auswerten könnten. Auch die Erstellung verfälschter Versionen von Avataren sind technisch längst machbar. Wie lassen sich heute Verstorbene und Hinterbliebene nachhaltig vor Manipulation schützen? Reicht da ein „digitaler letzter Wille“: eine Verfügung, die festlegt, ob und wie ein Verstorbener weiterexistiert?
Auch bei den Geisterfotos dauerte es Jahrzehnte mühsamer Verfahren gegen fast jede einzelne Manipulationsmethode von Mumlers Nachfolgern, bis sie erst in den 1920-er Jahren nachhaltig entzaubert wurden. Noch während des Ersten Weltkriegs stieg in England erneut die Nachfrage an Geisterfotos: Waren sie nicht ein letzter Gruß der Gefallenen an die Angehörigen?
=> Wie Avatare das Gedenken beeinflussen und unsere Erinnerungen an Verstorbene erstarren lassen