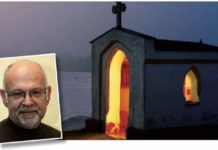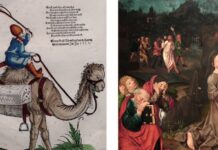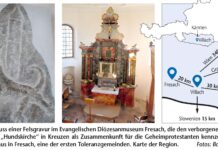Tot, aber online: Künstliche Erinnerungen digitaler Zwillinge von Verstorbenen
Digitale Zwillinge oder Avatare, also virtuelle Abbilder von Verstorbenen, eröffnen neue Möglichkeiten, Erinnerungen zu bewahren – und werfen zugleich tiefgreifende ethische, psychologische und ökonomische Fragen auf. Die Idee, mit einem geliebten Menschen sprechen zu können, auch wenn dieser längst tot ist, fasziniert viele und erscheint tröstlich. Gleichzeitig erscheint es als unheimlich, mit einer Person zu sprechen, die nicht mehr auf dieser Erde weilt.
Die Stimme klingt vertraut. Warm, ruhig, ein wenig ironisch, wie immer. Sie erzählt Anekdoten aus einem längst vergangenen Urlaub – wie die Frau vor dem Bildschirm als kleines Mädchen bei einer Bergwanderung auf einer glitschigen Brücke dermaßen herumturnte, dass es fast in den kalten Bach gestürzt wäre. Gerade rechtzeitig konnte ihr Vater sie noch halten.
Nun erinnern sich beide viele Jahrzehnte später daran. Nur dass die Person, mit der sich unsere Frau gerade unterhält, schon seit Monaten tot ist. Aus den Tiefen des weltweiten Netzes spricht ein digitales Abbild ihres verstorbenen Vaters mit ihr – ein digitaler Zwilling, gespeist aus alten Sprachaufnahmen, Erinnerungen, Fotos und Chatverläufen.
Verschiedene Wege führen heute zum „Leben nach dem Tod“ im Netz – und sie lassen sich kombinieren. Der erste: Menschen gestalten ihr digitales Nachleben selbst. Schon zu Lebzeiten erzählen sie, oft in langen KI-Interviews, von Kindheit, Familie, Urlaub, Liebe, Beruf, Träumen. Ihre Antworten, ihre Sprache, ihr Denken fließen in ein Modell, das sie später nachahmen kann. Mit Sprachsynthese entsteht sogar die vertraute Stimme: Sie spricht Sätze, die der Mensch nie gesagt hat, und klingt dabei echt.
Der zweite Weg: Die Hinterbliebenen schaffen den Avatar. Fotos, Videos, Tonaufnahmen, ihre Erinnerungen – alles wird zum Rohstoff für die künstliche Wiedergeburt. Je mehr Material vorhanden ist, desto realistischer erscheint das digitale Gegenüber. Für viele ist das Teil ihrer Trauerarbeit: Noch einmal mit dem Vater sprechen, die Mutter lachen hören, das Gesicht sehen, das fehlt.
Und schließlich der dritte, unheimlichste Weg: Eine KI durchstreift das Internet nach den Spuren des Verstorbenen – Posts, Mails, Suchverläufe, Kommentare. Kaum jemand weiß, was sie alles findet. Doch bilden diese Bruchstücke wirklich das Wesen eines Menschen ab? Oder nur ein verzerrtes Echo? Spätestens hier verschwimmt die Grenze zwischen Erinnerung und Fiktion.
Selbst wenn ein Avatar bewusst geschaffen wurde, bleibt die Frage: Greift die KI auf fremde Daten zurück, um Lücken zu füllen? „Halluziniert“ sie Erlebnisse oder Eigenschaften, die nie existierten?
Nun, an das Abenteuer am Gebirgsbach kann sich unsere Hinterbliebene noch selbst eindrücklich erinnern. Doch was ist mit Erinnerungen aus der Kindheit ihres Vaters? Wie sollen Angehörige erkennen, was echt ist – und was die Maschine hinzuerfindet?
„Ewige“ Erinnerung nötig?
Daneben drängt eine andere Frage ans Tageslicht – die bereits Max Frisch 1946 in seinem Essay „Du sollst dir kein Bildnis machen“ formulierte: Wer einen Menschen auf exakte Vorstellungen festlegt, nimmt ihm das Lebendige, die Möglichkeit der Entwicklung. Ein Avatar droht genau dieses Bildnis zu verfestigen. Wer einen Menschen auf exakte Vorstellungen festlegt, nimmt ihm das Lebendige, die Möglichkeiten zur Entwicklung.
Unser Bild vom anderen beeinflusst, wie dieser sich entfaltet. Menschen werden oft zu dem, was andere in ihnen sehen – sei es durch Zustimmung oder durch Widerstand. Indem wir an unseren Vorstellungen festhalten, verhindern wir Veränderung – und werden selbst zum Spiegel eines erstarrten Menschenbildes.
Und dabei sollen alle Erinnerungen „ewig“ fortbestehen, so werben die Betreiberfirmen, die Avatare auf den Markt bringen wollen. Nichts mehr soll mit dem Tod verblassen.
Doch hat das Abenteuer am Gebirgsbach für die Kinder unserer Hinterbliebenen die gleiche Bedeutung wie für sie? Wissen sie denn noch, wo sie damals unterwegs war? Oder werden sie nur den Kopf schütteln, wie unvorsichtig ihre Mutter war?
Das menschliche Gedächtnis lebt vom Aussortieren, vom Verblassen, vom Verschwinden. Es schafft Bedeutung gerade dadurch, dass es nicht alles bewahrt. Ewige Erinnerungen sind wie ein übervoller Keller, in dem nichts aussortiert werden darf – auch das Banale und Belanglose nicht. Wer steigt da noch hindurch?
Vielleicht müsste auch ein Avatar irgendwann ruhen dürfen. Was aber, wenn es für die Hinterbliebenen zur Unzeit geschieht: die Server abgeschaltet werden, der Anbieter insolvent geht oder Daten verkauft werden? Wird der Avatar gelöscht, recycelt oder zur Grundlage des nächsten KI-Modells?
Blick in erstarrte Spiegel
Der Traum, mit den Toten zu sprechen, begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden. Nun scheint er technisch greifbar. Doch je näher er rückt, desto drängender werden die Fragen, welche Erinnerungen er spiegeln soll, wenn er sie in derart feste Formen gießt. Gerade wenn mehrere Hinterbliebene den digitalen Zwilling gemeinsam gestalten, scheint ein massives Konfliktpotential eher vorstellbar als gemeinsame Erinnerungsarbeit. Auch der Bruder unserer Hinterbliebenen hat eher die Erinnerung an den Vater als erfolgreichen aber oft gestressten Geschäftsmann. Wer „besitzt“ die „richtige“ Erinnerung?
Und was, wenn sich Angehörige und Historiker über die Darstellung eines bekannten Menschen streiten? Die Konflikte um das Erbe Helmut Kohls zeigen, welche Probleme da entstehen kann – ein Avatar würde das nur vervielfachen.
Welches Bild und welches Entwicklungsstadium eines Menschen bleiben im Avatar bestehen? Der Bruder unserer Hinterbliebenen konnte sich erst wieder an den Vater annähern, als dieser als gereifter Pensionär zur Ruhe kam.
Kann und muss ein Avatar sich weiterentwickeln? Darf er oder sie altern, die Mode kommender Jahrzehnte anziehen, sich an den neuesten Stand der Technik anpassen?
Es zeigt sich: Avatare spiegeln das menschliche Bedürfnis nach Dauer und der Angst vor Verlusten. Sie schaffen die Illusion endloser Nähe. Doch digitale Unsterblichkeit ist kein Leben. Max Frischs Warnung klingt hier neu und dringlich.
Vielleicht endet das Leben nicht dort, wo die Maschinen der Intensivstation an ihre Grenzen kommen oder Daten versiegen. Nein, eher dann, wenn die Erinnerung an einen Menschen und die Beziehung zu ihm dermaßen eingefroren ist, dass aus sich selbst heraus keinerlei Entwicklung mehr geschieht.
=> Wie Avatare zwischen Brot und Täuschung Bedürfnisse erfüllen und das Gedenken verändern