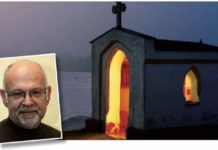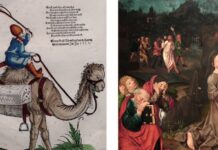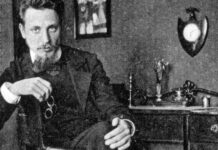Wie Kinder und Konfirmanden das Kriegsende in Frankens Dörfern erlebten – eine Erinnerung
Vor zehn Jahren fragten wir bei Ihnen nach Ihrem Rückblick auf das Kriegsende 1945. Viele werden sich erinnern. Damals lag es 70 Jahre zurück. Es erreichten uns viele Anrufe und Briefe. Teilweise schickten uns Ehefrauen oder Kinder handgeschriebene Bücher oder Tagebuchnotizen zu.
„Es ist das letzte Mal“, so dachten wir bereits damals, „dass wir die Gelegenheit dazu haben.“ Nun liegen alle Erinnerungen noch einmal zehn Jahre länger zurück. Daher haben wir in diesem Jahr auf einen ähnlichen Aufruf verzichtet. Viele derjenigen, die uns vor zehn Jahren ihre Geschichten erzählten, weilen leider heute nicht mehr unter uns: Auch mindestens fünf Zeitzeugen aus dem Jahr 2015.
Das Kriegsende im ländlichen Franken nahm vor zehn Jahren noch einmal aus den berührenden Erinnerungen damaliger Kinder und Konfirmanden Gestalt an. So wollen wir einige Ihrer Erinnerungen aus dem Jahr 2015 nun weitertragen. Doch damals konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass der Krieg zurückkehrt! Manche der Erinnerungen, dass die Bauern etwa mit ihren Kindern unter Beschuss die Felder bestellen mussten, sind uns in den vergangenen drei Jahren in ähnlicher Form in der Ukraine wieder begegnet.
Denn trotz Tieffliegern und den letzten Rückzugsgefechten musste auch im Frühjahr 1945 die Ernte ausgebracht werden. Da waren auch viele Kinder und Jugendliche in den mittelfränkischen Dörfern mit dabei. Wurde der Beschuss gar zu schlimm, verkrochen sie sich unter Wägen oder flüchteten in die nahen Wäldchen.
Auch viele Ställe wurden getroffen. Vieh, das panisch aus verbrannten Ställen entkam und mühsam wieder eingefangen werden musste, ist uns wieder näher gerückt. Anna Hübsch aus Colmberg behielt jedoch gegenüber einer verwundeten Kuh die Ruhe. Sie holte das verwirrte Tier mitten aus einem Konvoi amerikanischer Fahrzeuge: „Ich ließ meinen Arm um ihren Hals und ging mit ihr zum nächsten Stall.“ Da brüllten alle anderen Kühe – sie rannte zu ihren Artgenossen.
Die damalige Konfirmandin Luise Schneider aus Kammerstein musste sich auf dem Rückweg nach der Einsegnung in ihrem Festtagsgewand in den schmutzigen Straßengraben werfen, um sich vor Tieffliegern zu schützen. Bei ihrer Rückkehr drohte ihr die Mutter Schläge an.
Allerdings spielten immer wieder kleinere Kinder aus der Nachbarschaft oder dem nahen Familienkreis mit Blindgängern oder weggeworfenen Waffen – immer wieder mit tödlichen Folgen.
Als die Mutter „vom Hühnerhaus in den Garten zurückwollte, schlug nur wenige Meter hinter ihr eine Panzergranate ein. Diese bohrte sich jedoch unter eine Sandsteinplatte, die wie ein Schutzschild wirkte“, so erinnerte sich vor zehn Jahren Ernst Veeh aus Gülchsheim bei Hemmersheim. Er selbst versuchte dann auch nicht mehr, die anrückenden Amerikaner vom Kirchturm aus zu beobachten.
Zwang zur Verteidigung
Immer wieder sollten die Dörfer noch fast mit der letzten Patrone verteidigt werden. Mit Holzbarrieren und eilig ausgehobenen Gräben sollten die amerikanischen Panzer aufgehalten werden. Die Dorfbewohner konnten zusehen, wie mühelos sie diese behelfsmäßigen Barrieren überwanden – oder einfach aus einer anderen Richtung kamen, an die niemand gedacht hatte.
Die damals neunjährige Luise Buckreus aus Hagenbüchbach erinnerte sich vor zehn Jahren, wie ihr Vater unter dem letzten Aufgebot gegen die Amerikaner kämpfen sollte. Er bezahlte mit seinem Leben.
Doch der Vater der damaligen Konfirmandin Elise Kroder – zu Kriegsende Mesner in Osternohe bei Schnaittach – wollte keine Schützengräben mehr ausheben. „Nur durch das Betteln und Weinen meiner Oma und Mutter und auch des Pfarrers gab er nach, denn er wäre sonst verhaftet worden“, erinnerte sich Elise Kroder. Gegenüber den vorrückenden Amerikanern hissten viele Familien der Umgebung die weiße Fahne. „Aber die SS kam wieder zurück und zündete alle Häuser mit weißer Fahne an.“
Der damals neunjährige Hans Henninger aus Marktbergel erlebte die „Vaterlandsverteidiger“ – Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die für einen erneuten Wehrdienst zu betagt waren – und „zehn Hitlerjungen“. Doch „sie versteckten ihre Waffen hinter Reisig und Holz und waren am Morgen verschwunden.“
In Vorra im Pegnitztal wollte noch ein Kommando die Eisenbahnbrücke sprengen. Ein Bauer hielt dagegen: „Ich hol‘ mei Gras-Sens‘ und hau euch die Köpf ab“ – er kam damit durch. Das Sprengkommando rückte unverrichteter Dinge ab, dem Bauern geschah nichts“, so Elfriede Stief, 2015 Puschendorfer Schwester.
Getroffen bei der Rückkehr
Der Vater der Schwestern Emilie Treier, Hedwig Hegwein und Luise Rüstellhuber (bei Kriegsende waren sie zwischen sieben und 13 Jahren) war als Landwirt und als Vater von insgesamt neun Kindern nicht eingezogen worden. Nur die beiden ältesten Brüder waren an der Front. Die restliche Familie Winter floh vor den herannahenden Kämpfen rund um die heutige Bundesstraße B13 – schon damals eine Verkehrsader – Anfang April 1945 vom Bauernhof in Gollhofen nach Uffenheim.
Nachdem die stärksten Kämpfe abgeflaut waren, ging Bauer Winter am 11. April zurück zu seinem Hof, um sich endlich wieder um das Vieh zu kümmern. „Ein Nachbar fand ihn“, so erinnerten sich die Schwestern vor zehn Jahren. Ein „erneuter Angriff hatte Vater den Fuß abgerissen. Er war verblutet.“
Die Mutter begann nun den Hof wieder herzurichten. Das Haus war noch halbwegs bewohnbar. Aber Scheunen und Ställe waren zerstört, viele Kühe verbrannt. Verletzte Tiere mussten geschlachtet werden. Andere mussten wieder aus den Wäldern gesucht und eingefangen werden.
Wenigstens war die Aussaat schon erfolgt, aber für die Ernte im Sommer fehlten immer noch die Scheunen, so dass sie draußen gelagert werden musste. Im Herbst 1945 kam der zweitälteste Bruder, „noch keine 18 Jahre“ heim. Aufgrund seiner Jugend war er schnell aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Er übernahm schnell die bäuerlichen Pflichten. Schon am Tag nach seiner Rückkehr begann er mit dem Dreschen, so die Schwestern.
Direkt nach Kriegsende gab es Einquartierungen von Ausgebombten und Geflüchteten gerade auf dem Land. Gerade für schwächere und ältere Menschen hielt sich die Bereitschaft zur Aufnahme in Grenzen. „ich habe mich so geschämt, weil niemand sie haben wollte“, so der Vater der Berichterstatterin Irmgard Wölfel, der mit einer alten Frau zur Einquartierung wiederkam. Doch sie konnte geschickt nähen – „ein Segen für das Haus“ .
Nur ganz langsam nahm der Alltag wieder Gestalt an – gerade für die Kinder und Konfirmanden damals, die damit aufgewachsen waren.