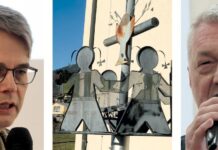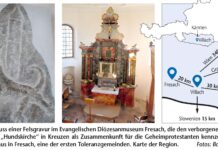Kommentar im Evangelischen Sonntagsblatt über die Verflechtung von Staat und Kirche von Raimund Kirch
Prolog: 1525 ist in der Kirchengeschichte ein bedeutsames Jahr. Als erste Großstadt wurde nach einem berühmten theologischen Disput (dem Religionsgespräch) Nürnberg evangelisch. Die Reformation war nicht mehr aufzuhalten. Und beispielgebend für weite Teile wurde die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenordnung. Sie regelte Pfarrerwahl und Besoldung, Amtshandlungen und Visitationen.
Nicht wenige Historiker wollen da schon Ansätze für eine fatale Hörigkeit der Kirche gegenüber dem Staat erkannt haben. Die Freiheit des Christenmenschen, wie sie Luther zuvor in seiner Sturm- und Drangzeit gepredigt hatte, wurde ihrer Meinung nach eingehegt. Obrigkeitsdenken kehrte ein. Kritiker wollen darin sogar die spätere fatale Duldung, ja sogar Hinwendung von weiten Teilen des Protestantismus zum Nazistaat sehen. Von einem solchen nationalistischen Christentum hat man sich später losgesagt.
Nicht so in den USA (und damit Schluss mit dem Vorwort); denn dort weiß sich US-Präsident Donald Trump von Evangelikalen und so genannten Mega-Churches, ja sogar von Teilen des rechtskonservativen Katholizismus getragen. Sie alle verkörpern ein nationalistisches Christentum. Das wundert umso mehr, weil Donald Trump von Haus aus weder ein Evangelikaler ist noch bis zu seinem ersten Wahlkampf auf den Zuspruch der Moral Majority, also dem politischen Arm der religiösen Rechten, setzen konnte.
Inzwischen hat sich die Situation jedoch grundsätzlich geändert wie sich dies auch und vor allem bei der Trauerfeier für den bei einem Attentat getöteten Wahlhelfer und rechten Influencer Charlie Kirk zeigte. Kirk war es gelungen, Jungwähler für Trump zu begeistern. Der wiederum feierte ihn als Märtyrer und schwor Rache und gnadenloses Vorgehen gegen die Linken, worunter er alle subsumiert, die nicht auf seiner Seite stehen. Seine Rede strotzte von Hassparolen und Unwahrheiten, auf seine Fans wirkt dies jedoch wie ein Rauschmittel.
Was aber heißt Christlicher Nationalismus in den USA? Eine Definition ist schwierig, da er sich aus verschiedenen Strömungen speist, die allesamt ausdrücklich die USA als christliche Nation bis hin zu religiöser Überlegenheit ihres militanten Christentums feiern. So entwickeln sie eine ganz eigene Wokeness, ein Begriff, gegen den sie scharf polemisieren. Wokeness bedeutet in ihren Augen nämlich übertriebenes Eintreten für Geschlechtergerechtigkeit, für Menschenrechte, gegen Diskriminierung von Minderheiten und Transsexualität.
Die religiöse Rechte hat sich inzwischen voll auf die Seite von Trumps MAGA-Bewegung (Make America Great Again) geschlagen und unterstützt damit den persönlichen Rachefeldzug des Präsidenten gegen alle, die ihm im Wege stehen, die für die Ablösung liberaler Richterinnen und Richter sind und bei der Jagd auf illegale Zuwanderer und der Untergrabung von Wahlregeln zugunsten der Republikaner alle Augen zudrücken.
Epilog: Kein Wunder, dass selbst Konservative in Deutschland, diese Praxis mit Grausen beobachten. Bemerkenswerterweise hat etwa der auf Tradition bedachte Passauer Bischof Stefan Oster die Rede Trumps bei der Trauerfeier für Charlie Kirk scharf verurteilt und ihm unchristliches Verhalten vorgeworfen. Offensichtlich dämmert nicht nur dem Bischof wie gefährlich es ist, wenn bestimmte religiöse Gruppe und die Politik sich, wie derzeit in den USA, zusammentun, um den Staat nach ihren Regeln neu zu programmieren.