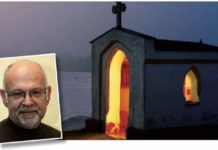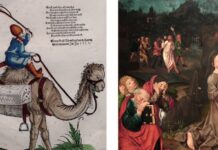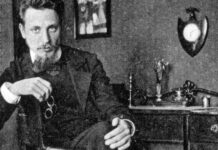Lebenslinien: Valentin Ickelsamer – der Schulmeister des Bauernkriegs auf unruhigen Pfaden
Je näher an Wittenberg, desto schlimmer die Christen.“ Mit diesen beißenden Worten begann Valentin Ickelsamer seine Abrechnung mit der Reformation. Was Luther und seine Mitstreiter einst Rom vorgeworfen hätten, gelte längst auch für sie selbst, schrieb er 1525 in seiner Flugschrift „Clag etlicher brüder“. Während Luther, in seiner Stube Bier trinke, so Ickelsamer, hungerten draußen die Armen. Seine Worte waren Sprengstoff – und sie trafen mitten in eine Zeit, in der Glauben, Macht und Aufruhr ein explosives Gemisch bildeten.
Im März 1525, als die „Clag“ erschien, stand auch Ickelsamers Heimat Rothenburg ob der Tauber am Rand des Abgrunds. Überall gärte der Zorn der Bauern, die gegen Unterdrückung und kirchliche Bevormundung aufbegehrten. Auch Ickelsamer war überzeugt, dass die Botschaft der Reformation auf den Feldern und Gassen gehört werden müsse.
Dabei hatte er sein Leben kurz zuvor noch nach auf Beständigkeit ausgerichtet. Ende 1524 war er als „Deutscher Schulmeister“ an die Tauber zurückgekehrt, um Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, die mit Latein wenig anfangen konnten. Er hatte Margarethe Popp geheiratet, die Tochter eines angesehenen Bürgers. Zum Bauernkriegs-Jubiläum haben zwei Aufsätze von Horst F. Rupp und Roy L. Vice Ickelsamers Gedankenwege neu untersucht und ihm dem Vergessen entrissen. Bislang erinnerte nur noch die örtliche Mittelschule an seinen Namen.
Geboren um das Jahr 1500 in Ohrenbach rund 15 Kilometer nördlich von Rothenburg, entstammte Ickelsamer wohl einer wohlhabenden Bauernfamilie. Wie genau er den Weg in die Gelehrtenwelt fand, ist unklar. Sicher ist nur, dass er sich im Wintersemester 1518/19 an der Uni Erfurt einschrieb – seine erste datierbare Spur. Zwei Jahre später erlangte er dort den Zwischenabschluss des Baccalaureus Artium und setzte seine Studien in Wittenberg fort.
Besonders beeindruckte ihn Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt – Luthers Mitstreiter, dann sein Rivale. Für Ickelsamer war Karlstadt der wahre Prophet der Erneuerung. So wie David einst König Saul abgelöst habe, werde Karlstadt „mit Gottes Hilfe“ Luther überflügeln, schrieb er in der „Clag“. Doch zu diesem Zeitpunkt war Karlstadt bereits aus Wittenberg vertrieben – und fand in Rothenburg Zuflucht.
Die Kinder des Aufstands
Doch Ickelsamer blieb auch mitten im Aufstand, an dem er sich aktiv beteiligte und für den er auch als Laienprediger eine Lanze brach, seiner pädagogischen Berufung treu: Bildung, davon war er überzeugt, müsse von unten beginnen. Im Mai 1525 erschien sein erstes Erziehungswerk: „Ein gespräch zweyer Kinder mit einander“. Darin diskutierten der kleine Johann und der kleine Jacob in fingierten Dialogen über den wahren Glauben, über Liebe, Armut und die Werke Christi.
Horst F. Rupp vermutet sogar nach älteren Quellen, dass die beiden realen Vorbildern nachempfunden waren: Johann, Sohn des Schusters Bürkle, und Jacob, der gleichnamige Sohn des Feldhüters Jacob Krebs. Dann entstammen sie gar dem einfachen Volk.
Ickelsamer wollte das Evangelium konsequent in der Sprache der Menschen verkünden. Auch die Kinder sollten nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, sondern sittliche Verantwortung. Doch kann man in der Art seiner Vermittlung „wenig von der reformatorischen Botschaft der frei machenden Liebe Gottes zu den Menschen“ erkennen. Trotzdem ein lebensgefährlicher Ansatz – spätestens als der Bauernkrieg blutig niedergeschlagen wurden. Ickelsamer floh im Juni 1525, ließ Besitz und zunächst auch seine Frau zurück. Auch Karlstadt konnte entkommen.
Nun begannen die Gewissensprüfungen: War der Bauernkrieg vielleicht doch kein Werk Gottes gewesen? Selbst Karlstadt suchte wieder Luthers Nähe. Auch Ickelsamer rang um Deutung. In zwei Briefen an den Rothenburger Rat schrieb er 1527, er hätte niemanden zur Rebellion ermutigt und sei gar gegenüber dem Rat loyal geblieben. Auch viele Obrigkeiten hätten Aufstand für Gottes Willen gehalten. Die Stadt sah das anders und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe und verbannte ihn auf Dauer.
Seine Rechtfertigungsschreiben zeugen von einem zutiefst verletzten Mann. Doch er gab nicht auf. Im selben Jahr veröffentlichte er sein Lehrbuch „Die rechte Weis, auf kürzest Lesen zu lernen“. Darin klagte er über den Zorn Gottes, bot aber zugleich Lesestoff für Anfänger – in Dialogform mit Anna und Margarete (bemerkenswerte Weise zwei Mädchen), die über Sünde, Erneuerung und das gottgefällige Leben sprachen. Seine Methode, Schreiben nach den menschlichen Lauten zu lehren, war bahnbrechend. Horst E. Rupp nennt Ickelsamer in diesem Sinn „kongenial zu Luther“, weil er die didaktische Vermittlung der deutschen Sprache revolutionierte.
Grammatik des Schweigens
1530 wurde Ickelsamer Schulmeister in Arnstadt bei Erfurt. Doch die Vergangenheit holte ihn ein. Der sächsische Kurfürst ließ ihn wegen seiner alten Verbindungen zu Bauern und Täufern verfolgen. Wieder floh er – erst nach Straßburg, dann nach Augsburg. Dort erschien 1533 sein Hauptwerk: „Ein Teutsche Grammatica“. Die herkömmliche Anwendung lateinischer Regeln auf das Deutsche, erklärte er, sei untauglich. Sprache müsse von innen verstanden werden – aus ihrem eigenen Geist heraus. Er warnte im Vorwort zur 2. Auflage 1537 vor Missbrauch. Gerade die Gabe zu lesen kann in den Irrtum und Stolz führen anstatt Gott zu ehren.
Da war er bereits auf Gleichgesinnte wie Caspar Schwenckfeld und Sebastian Franck getroffen, die den Glauben verinnerlichen wollten. Sie predigten Einkehr und Schweigen. Auch Ickelsamer, der das Wort auf die Straße getragen hatte, suchte nun Stille und Abstand von der Welt.
Als er um 1547 starb, war von seinem kämpferischen Geist wenig geblieben. Trotz aller Resignation hinterließ er als Vermächtnis den Glauben an Bildung als Weg zu
Gerechtigkeit – und an das Recht jedes Menschen, selbst zu verstehen.
Horst F. Rupp: Valentin Ickelsamer und seine Schrift „Clag etlicher brüder …“ … (S. 131–152). In ders./Gerhard Simon (Hg.): Der Rothenburger Prediger Johannes Teuschlein …, Verlag Josef Fink 2024; ISBN 978-3-95976-508-4, 272 Seiten, 39 Euro.
Roy L. Vice: Valentin Ickelsamer – Seine Wandlung vom Rebellen zum Quietisten (S. 63–85). In ders./Markus Hirte (Hg): Rothenburg im Bauernkrieg. Herder 2025, ISBN 978-3-534-64312-7, 368 Seiten, 28 Euro.