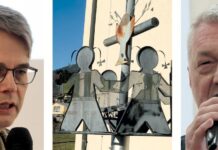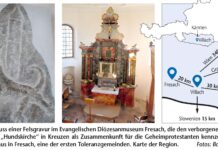Editorial im Evangelischen Sonntagsblatt von Raimund Kirch, Mitglied im Herausgeberbeirat, Ex-Chefredakteur der Nürnberger Zeitung
„Wye lange slafft yr … schmeychelt nit lenger den vorkarten fantasten … fanget an und streytet den Streyth des Herren!“. Als der Prediger Thomas Müntzer am 26. April 1525 diesen Kampfaufruf gegen Feudalherren und Unterdrücker in der thüringischen Reichsstadt Mühlhausen schrieb, hatte er gerade noch einen Monat zu leben. Am 27. Mai ist er nach Gefangennahme und Folter am Ort seines früheren Wirkens enthauptet worden. Im nicht allzuweit entfernten Wittenberg soll sein Gegenspieler, mit dem er noch bis 1520 kollegial verbunden war, frohlockt haben.
In diesen Tagen und Wochen wird viel über den Bauernkrieg geredet. Auch das Rothenburger Evangelischen Sonntagsblatt hat von den Anfängen in Süddeutschand berichtet. Und es widmet sich jetzt den Ereignissen in Franken.
Wie ein Lauffeuer hat sich der Aufstand Anfang 1525 ausgebreitet, offenbar war das Fass übergelaufen, in dem die Wut über Ausbeutung, Erniedrigung und nicht zuletzt – die lutherische Lehre von der Freiheit des Christenmenschen – gegärt hatten.
Wobei die erwähnten Zwölf Artikel von Memmingen durchaus als erstes menschenrechtliches Dokument gesehen werden kann, das bis in die Zeit der Aufklärung und letztlich bis heute eine nicht zu verachtende Wirkung hat. Natürlich darf man den Einfluss von Religion und Glauben dabei nicht unterschätzen. Die Oxforder Historikerin Lyndal Roper hat dies herausgearbeitet. So habe jeder der Memminger Artikel einen starken Bezug zum Evangelium, wie etwa der dritte, in dem es heißt, dass Christus mit seinem „kostbarlichen Blutvergießen“ alle erlöse. Arme wie Reiche. Durch die Schrift sei bewiesen, dass „wir frei sein sollen“.
Für Roper ist die religiöse Freiheitsidee folglich der Schlüsselbegriff der Revolte. Die anfänglichen Erfolge der Bauernhaufen bedeuteten andererseits schon ihr absehbares Scheitern. Das Niederbrennen der Adelssitze und das anarchische Verhalten einzelner Haufen, die nicht mehr in Griffe zu bekommen waren, hatte die geballte Gegenwehr der Regierenden zur Folge, die sich dann auf Müntzers Gegner Martin Luther beziehen konnten.
Den tragischen Ausgang kennen wir. Die Historikerin Lyndal Roper sieht seitdem eine Ernüchterung der Landbevölkerung über die Reformation als Ganzes. Noch Jahrzehnte nach 1525 seien evangelische Pfarrer auf ein Widerstreben in der Bauernschaft gestoßen.